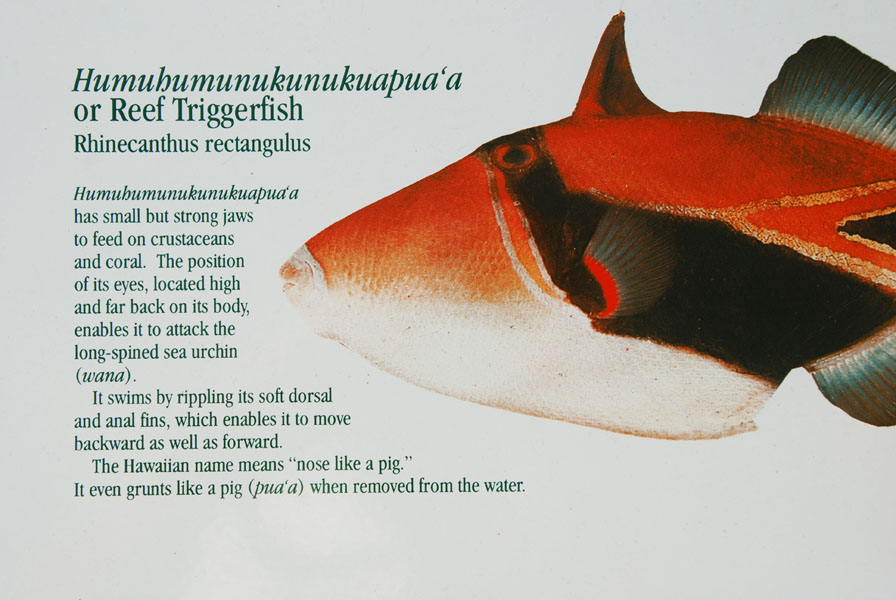Die Zivilisierte!
02.12.2008 – 04.12.2008
HAWAII: OAHU MIT HONOLULU
HO-NO-LU-LU. Das muss man sich ganz, ganz gemächlich, ähnlich einer ausgezeichneten Schokolade, auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Name. Dieser Klang. Sehnsüchte weckend! Als kleines Kind war dies der Name, das Synonym für ganz, ganz weit weg. Für das Paradies! Man dachte sich, einmal im Leben wolle man dahin. Damals, vor langer Zeit, hatte man nicht die geringste Ahnung, wo dieser magische Ort liegt. Auf der anderen Seite der Welt. Dort jedoch, dachte man, hängt man ja mit dem Kopf nach unten, fällt dann einfach von der Welt runter und verschwindet in den Tiefen der Endlosigkeit. Schwerkraft? Unbekannt, damals. Und sicher dachten die Kinder auf dieser Seite der Erde das Gleiche: in München hängt man mit dem Kopf nach unten und …
Zwischen fast erfroren und der Hochautobahn – angekommen!
Der erste Eindruck von Honolulu ist, gepaart mit dem Erinnern an die Gedanken der Kindheit, eher, ja…, schwer zu sagen. Irgendwie eine Mischung aus Ahas! und Ohos!. Das erträumte Paradies in Beton gegossen? Einzig die Wärme und das Schild „Welcome to Honolulu“ versichern uns, wirklich in Honolulu zu sein. Aus dem schmucklosen Terminal heraus geht es auf die Suche nach dem Mietwagenverleiher. Nach der Ruhe und Beschaulichkeit von Kauai ist diese Hektik, Urbanität und Größe verwirrend. An einem winzigen Schalter, dessen Größe eher an einen Provinzflughafen in der Lüneburger Heide erinnert, weist ein Schild den Neuankömmling den Weg zum „Shuttle“.
Diese Shuttle sind, sollte es jemals so weit kommen in dieser warmen Region, Brutstätte und Hort inselweiter Grippewellen. Draußen hat es angenehme 28°C, mit T-Shirt, Blumenshorts und Flipflops bekleidet, erklimmen wir die Stufen des Busses und betreten eine neue Klimazone: Schockfrost! Auch wenn nichts mehr in den USA funktioniert, die Klimaanlagen schon. Das Innere des Busses ist auf gefühlte 0°C runter gekühlt. Der Pulli sicher verstaut, ganz unten in der Tasche, unter den Badehosen und dem Aspirin Plus C. Naja, die Fahrt wird schon nicht ewig dauern…
Unter dem sechsspurigen (eine Fahrtrichtung) Kamehameha Highway, hier als Hochautobahn, geht es auf dem Nimitz Highway durch ein dunkles, graues und bedrückendes Tal aus Beton und Lagerhäusern. Und das soll es sein? Das Ziel unsere Kindheitsträume? Warum haben wir nicht vom Allgäu oder der Toskana geträumt? Nach einer endlos erscheinenden Fahrt im „Tiefkühllaster“ biegen wir auf den Hof der Autovermietung ein, steigen aus und eilen erst einmal an einen sonnigen Fleck, um aufzutauen. Ein leises Hatschi und ein Schaudern von den Temperaturunterschiede später tauen die Gelenke auf, knirschen nicht mehr. Nach dem üblichen Prozedere und dem wiederholten Erklären, dass Führerscheine in Deutschland kein Ablaufdatum haben, geht es los. Auf nach Waikiki! Waikiki Beach!
Einmal aus den Tiefen des tristen Nimitz Highways auf dem Freeway, liegen die Betontäler unter uns, und vor uns öffnet sich die Skyline von Honolulu. Ein bisschen wie New York am Strand. Eines ist uns inzwischen klar: die Schönheit der Insel muss woanders liegen. Nur wo?
Das Halekulani – eine Legende am Wakiki Beach
Kauai war aus Sicht des ortsunkundigen Autofahrers einfach: raus aus der Stadt, rechts, geradeaus, links und dann noch einmal links und angekommen! In Honolulu schaut es dagegen schon anders aus. Die Stadt ist nicht im Schachbrettmuster angelegt, die Straßen enden oder führen nicht dahin, wohin sie sollen oder wir es wollen. Nach einer repräsentativen Irrfahrt entlang den Hotelburgen und dem Hafen überfahren wir beinahe einen ahnungs- und scheinbar augenlosen Touristen. Ein erschrockener und ein panischer Blick treffen sich kurz: äh, sorry!
Aber dann. Vor uns öffnet sich die Auffahrt zu unserem temporären Domizil in Honolulu. Das Halekulani. Am weltberühmten Waikiki-Beach! Bereits 1907 als Hau Tree-Hotel eröffnet und somit für amerikanische Verhältnisse ein Urgestein der Hotellerie. Das Halekulani ist eines jener einzigartigen, auf eine unerklärliche, ja fast mythische Weise aus der Masse der unendlichen Übernachtungsstätten herausragenden Hotels.
Auch für Nicht-Hotel-Aficionados ist es ein Name, ein Hotel mit dem gewissen Etwas, dem Ruf, dem Verlangen, Exotik und tropische Wunderwelten zu erreisen, Teil einer Legende zu sein oder gar zu werden. Wie sagte Eugene Cernan, bis heute der letzte Mensch, der über den Mond spazierte: „Thought I’d already been to heaven until I came to Halekulani…“ Honolulu und sein Halekulani ist wie New York und dessen Waldorf Astoria, Wien und sein Hotel Sacher, Mallorca und das Formentor oder St. Moritz und das Badrutt’s Palace-Hotel (samt Playboy Gunther Sachs allerdings).
Dieses Hotel hat keine Türen, müsste man ja bei diesem Wetter hier auch nie schließen. Eine frische Brise treibt den Duft von Meer und Blumen aufeinander und schafft so einen einzigartigen Wohlgeruch.Im Pool, tief blau, eine in den Boden eingelegte Orchidee aus 1,2 Millionen winzigen Glasmosaiksteinchen. Das Hotel umrahmt in einer Art „U“ den Pool, das ehemalige Herrenhaus und eben den legendären Waikiki Beach. Vom achten Stock haben wir eine wunderbare Aussicht. Der Blick schweift über das satte Grün des gepflegten Rasens, den schmalen Strand und das türkise Wasser des Pazifiks. Am Horizont, am Riff, ist das Kräuseln der Wellen zu sehen. Innerhalb des Riffs ist das Wasser still, fast wie ein See. Draußen, vor dem Riff, noch nicht gebremst, erkennt man die hohen Wellen. Mit lautem Getöse und Myriaden von Tropfen, die sich Diamanten gleich in alle Richtungen verteilen, wird das Meer gebremst.
Unsere Entdeckergeister sind wieder geweckt!
Geschichte im Zeitraffer – vom Napoleon Hawaiis bis Obama
Kamehameha (= „der Einsame“), später König Kamehameha I. wird wahrscheinlich 1758 auf Big Island geboren. Im Alter von 14 Jahren wird er von seinem Onkel König Kalaniopuu (König von Big Island) adoptiert. Im Januar 1778 „entdeckt“ Captain James Cook Hawaii und landet auf Kauai. Mit diesem Datum ist das Ende der Abgeschiedenheit, jedoch zugleich der Beginn einer neuen Dynastie verbunden. Kamehameha lernt von den Entdeckern den Gebrauch von Gewehren und Kanonen. Mit diesem Wissen und modern bewaffnet macht er sich auf, die weiteren Inseln des Archipels zu erobern. Auf Maui (1790) lässt er die gegnerischen Krieger, allesamt mit Pfeil und Bogen bewaffnet, so lange mit Kanonen beschießen, bis sich wirklich niemand mehr rührt.
1791 erledigt der kaltblütige Kamehameha seinen Widersacher auf Big Island, wobei ihm die Vulkangöttin Pele zu Hilfe gekommen ist: der mickrige Rest von 400 gegnerischen Kriegern stirbt elendig und qualvoll in einem von Pele geschickten Vulkanausbruch. Entweder werden sie von der glühendheißen Lava überrollt und vaporisiert oder ersticken in den giftigen Gasen.
 Auf Oahu (1795) spart Kamehameha Munition, die göttliche Pele kommt ihm auch nicht zu Hilfe und so treibt der grausame Eroberer seine Gegner mit Macheten und Gewehren vor sich her in das Nuuanu Tal. Hier, keinen Ausweg wissend, stürzen sich die verbliebenen mehrere hundert Verteidiger die 200 Meter hohen Klippen hinunter. Kauai, inzwischen wieder selbstständig, kann sich Kamehameha, inzwischen Kamehameha I., nur durch Diplomatie und Heirat sichern. 1810 hat es der „Einsame“ geschafft: König Kamahemeha I. hat das Königreich Hawaii geschaffen. Diese Dynastie sollte noch fast 100 Jahre dauern, ehe es das imperialistische und einen geeigneten militärischen Stützpunkt suchende Amerika „schluckt“.
Auf Oahu (1795) spart Kamehameha Munition, die göttliche Pele kommt ihm auch nicht zu Hilfe und so treibt der grausame Eroberer seine Gegner mit Macheten und Gewehren vor sich her in das Nuuanu Tal. Hier, keinen Ausweg wissend, stürzen sich die verbliebenen mehrere hundert Verteidiger die 200 Meter hohen Klippen hinunter. Kauai, inzwischen wieder selbstständig, kann sich Kamehameha, inzwischen Kamehameha I., nur durch Diplomatie und Heirat sichern. 1810 hat es der „Einsame“ geschafft: König Kamahemeha I. hat das Königreich Hawaii geschaffen. Diese Dynastie sollte noch fast 100 Jahre dauern, ehe es das imperialistische und einen geeigneten militärischen Stützpunkt suchende Amerika „schluckt“.
Kamehameha I stirbt im Mai 1819 und hinterlasst eine machtverliebte Frau und einen politisch eher unfähigen Sohn. Mit dem Tod Kamehamehas beginnt das Chaos: sein wenig begabter Sohn, Liholio oder Kamehameha II., stirbt 1824 in England an der Grippe. Schon vorher hat seine Mutter ihm immer ins Handwerk gepfuscht, und er ist nie ein König im Sinne seines Vaters gewesen. Als Nachfolger wird Liholios 10-jähriger Bruder auf den Thron gesetzt. Und wieder ist die Mutter die eigentliche Macht im Lande.
Das geht schließlich noch einige Jahre so weiter. Mal ist der Regent fähiger, mal weniger. Der letzte Abkömmling der Kamehameha-Dynastie, Kamehameha V., hinterlässt 1872 keinen Nachkommen. Aus mit König! Nun muss ein König gewählt werden. Eine nette Idee, aber irgendwie ist es dem Prinzip Monarchie nicht eigen, seine Könige zu wählen. Dafür gibt es andere Regierungsformen.
Der nächste König, der vom Volk gewählte Lunalilo, stirbt bereits nach 13 Monaten im Amt. Und wieder muss ein König gewählt werden. Diesmal wuird es der lebenslustige und fröhliche David Kalakaua. Es ist das Jahr 1874. Auf den Inseln wird König Kalakaua heute noch als Art „Party König“ verehrt. Er führt eine neue Währung ein, den Kalakaua-Dollar, feiert seine Feste, und eigentlich ist alles in Ordnung. Der wachsende Einfluss der amerikanischstämmigen Zuckerbarone, die wegen des erstarkenden hawaiischen Nationalgefühls und Selbstbewusstseins um ihre Ländereien und Reichtümer fürchten, führt jedoch 1871 zu einem unblutigen Staatsstreich. König Kalakaua, inzwischen alt und schwach, geht nach San Francisco, wo er auch stirbt. Als Nachfolgerin hat er seine Schwester Liliuokalani bestimmt. Diese ist dann auch die letzte Königin von Hawaii. Unter ihrer Federführung versuchten die Ureinwohner den Aufstand, scheitern und Königin Liliuokalani wird in ihren Palast geschickt. Hausarrest.
Am 16. Januar 1893 endet das hawaiische Königsreich. Der amerikanische Botschafter „putscht“ mit Hilfe von 160 Marines, und Hawaii wird ein US-Territory und am 21. August 1959 wurde Hawaii der 52. Bundesstaat der USA. Erst Präsident Bill Clinton erkennt das damalige Unrecht an und unterschreibt am 23. November 1993 die Apology-Resolution. Eine medial effektvolle, jedoch für die Ur-Hawaiier wenig hilfreiche Geste. Inzwischen gibt es eine „zweite“ Regierung auf Hawaii, die sich um die Loslösung des Bundesstaates von den USA bemüht. Ob dies mit einem Präsidenten Obama, der auf Hawaii aufgewachsen ist und schon für seine „von Aloha geprägte Politik“ (New York Times, 23. Dezember`08) gelobt wird, möglich ist?
Honolulu Downtown und Kamehameha I. kommt aus Bremen
Denkt man darüber nach, ist es eigentlich seltsam, mitten im Pazifik, auf einer der isoliertesten Inseln der Welt (nach Kalifornien sind es 3.827 km, nach Tokio 6.190 km und nach Papeete/Tahiti 4.410 km) eine Großstadt mit all seinen Facetten vorzufinden. Hochhäuser, Einkaufszentren, Staus, beschlipste Geschäftsleute, quirliges Treiben und natürlich eine Chinatown.
Rund um den Königspalast der letzten beiden Könige, König Kalakaua und Königin Liliuokali – dem Iolani-Palast – spielt sich das gesellschaftliche, administrative und politische Leben Honolulus ab. Besonders bemerkenswert am Iolani-Palast ist die Tatsache, dass er der einzige Königspalast der USA ist! Nach dem Sturz der Monarchie hatte das Gebäude einige Verwendungen, unter anderem war es die Tagungsstätte des Parlaments und der Regierung. Von innen wie von außen erinnert der Palast an einen Mix aus viktorianischer und florentinischer Baukunst. Dies zeigt eindrucksvoll den damaligen Willen der Könige, nicht als wilde Paradiesvögel oder Speer werfende Könige, sondern Machthaber im globalen Monopoly der Machtblöcke wahrgenommen zu werden.
Der Palast ist 1882 fertig gestellt worden und für amerikanische Verständnisse somit so schrecklich alt, dass man sich als Besucher farblich grauenhaft abgestimmte Überschuhe aus Polyester anziehen muss, um eintreten zu dürfen. Was uns erstaunt, ist, dass diese Schlappen keine Gumminoppen an der Sohle haben, denn mit ein bisschen Anlauf kann man damit herrlich über das blitzeblanke Parkett schlittern (und sich mächtig Ärger von den Museumswärtern einholen). Wie üblich in Amerika sollte hier „for your own safety“ eigentlich vorgebeugt werden. Mit Adleraugen wird des Weiteren beobachtet, ob man (aus Versehen oder mit Absicht) ein Geländer oder einen Türstock berührt. Passiert dies, erfolgt stante pede die Ermahnung, der Schweiß zerstöre dieses historische Baudenkmal. Das Gebäude, in dem wir in München wohnen, ist ungefähr aus der gleichen Zeit, und da bohren wir sogar Löcher in die Wand – zugegebenermaßen ist es jedoch kein Königspalast.
Gegenüber dem Iolani-Palast befindet sich die Kamehameha-Statue. Diese stellt Kamehameha I. dar, mit einem Pfeil in der Hand in ein goldenes Gewand gehüllt. Nur leider ist diese Statue eine schlechte Kopie des Originals. Das Original wurde seinerzeit von König Kalakaua in Paris in Auftrag gegeben. Von dort wurde es nach Bremen gebracht, um nach Hawaii verschifft zu werden. Leider, das Projekt stand scheinbar unter keinem guten Stern, sank das Schiff, die „Georg Friedrich Händel“, vor den Falklandinseln. Da die Statue mit einem höheren Wert als der Anschaffungspreis versichert war, entschloss man sich kurzerhand, eine neue herstellen zu lassen. Nur war inzwischen der begabte Künstler verstorben und somit fiel die Neuerschaffung in die Hände seines weniger begabten Sohnes. Die Kopie war nicht so schön, kam aber immerhin in Honolulu an und wurde auch aufgestellt. „Hat ja koscht“, wie der Schwabe sagen würde! Inzwischen haben Fischer der Falklandinseln die Statue geborgen und – ohne zu wissen, wer der Dargestellte ist – in Port Stanley aufgestellt. Dort, so will es der Zufall, entdeckte ein amerikanischer Kapitän die Statue, erkannte Kamehameha I., kaufte sie und brachte sie nach Honolulu. Hier hatte man sich jedoch so an die Kopie gewöhnt, dass das weitaus schönere Original nun am Geburtsort des Königs, im Norden von Big Island, in einer ärmlichen und ländlichen Gegend aufgestellt wurde.
Zwei Blocks weiter, im Rathaus, lernen wir Leburta kennen kennen. Sie ist für die Abwässer der Stadt zuständig und an diesem Tag gerade für das Schmücken der Aula des Rathauses. Jede Abteilung ist für einen Weihnachtsbaum oder Ähnliches verantwortlich, das unter großer Begeisterung in der Aula aufgebaut wird. Nach ein bisschen Überreden schaffen wir es, Leburta einen rosa Schaumstoffmuffin als Christbaumschmuck abzuschwatzen. Sie hat diese selber gebastelt, und wir versprechen, nächstes Jahr ein Foto von „ihrem“ Muffin an einem deutschen Christbaum zu schicken. Es ist zwar alles ein bisschen kitschig, aber in Sachen Einfallsreichtum (z.B. Kaugummi Christbaum) kaum zu schlagen.
Der Aloha Tower und das gewisse Etwas
Vor den Zeiten von Jumbo-Jets und Massentourismus kamen die Besucher an Bord zahlreicher Kreuzfahrtschiffe nach Hawaii. Um diese schon von Weitem begrüßen zu können, baute man 1926 das mit 10 Stockwerken einst höchste Gebäude des Archipels, den Aloha-Tower. Der Aloha-Tower, an dessen Spitze wirklich das Wort „Aloha“ prangt (und das in alle vier Himmelsrichtungen), hinterließ bei den Ankömmlingen einen enormen Eindruck, konnten sich die wenigsten doch ein solches Bauwerk mitten im Pazifik vorstellen. Natürlich erklimmen auch wir die Aussichtsplattform, nicht jedoch ohne vorher von einem ca. 105 Jahre alten Sicherheitsbeamten unsere Taschen durchsuchen lassen zu müssen. Der Aloha-Tower stehe ja schließlich ganz oben auf der Abschussliste Osama Bin Ladens… Einmal oben angekommen, bieten sich wunderbare Ausblicke: über den Hafen, Waikiki samt Beach, die Stadt mit ihren Hochhäusern und den dahinter in den Bergen liegenden Regenwald.
 Was haben wir nicht alles über Oahu und Honolulu gehört. Von „grauenhaft“ über „der Ballermann der Amis“ bis zu „einer der hässlichsten Orte der Welt“. All diesen Unkenrufen zum Trotz genießen wir die Stadt und finden sie obendrein noch wirklich schön! Nicht schön im klassischen Sinn von schön, so wie man sagt, Florenz ist schön. Nein, was Honolulu hat, ist das gewisse Etwas. Die Menschen hier sind extrem freundlich (erstaunlich, bei über 7 Mio. Besuchern im Jahr), hilfsbereit und zusammen strahlt das einen ganz eigenen Charme aus. Es gibt nette Cafés, Kneipen und sogar Restaurants, die etwas anderes als Burger, Pommes oder Caesar’s Salad anbieten. Irgendwie ist es dann auch komisch, über die Kalakaua Avenue zu bummeln. Hier finden sich all jene Läden, die sich auch auf der Fifth Avenue in New York oder der Maximilianstraße in München finden. Auch wenn es irgendwie logisch ist, solche Läden auch hier zu finden, ist es doch auch seltsam. Aber von den 900.000 Einwohnern Oahus (75% aller Bewohner des Archipels) wird es wohl auch den einen oder anderen geben, der hier lebt und dementsprechend shoppt. Die Jaguars und Mercedes’ vor den Türen mit hawaiischen Kennzeichen lassen auf jeden Fall darauf schließen.
Was haben wir nicht alles über Oahu und Honolulu gehört. Von „grauenhaft“ über „der Ballermann der Amis“ bis zu „einer der hässlichsten Orte der Welt“. All diesen Unkenrufen zum Trotz genießen wir die Stadt und finden sie obendrein noch wirklich schön! Nicht schön im klassischen Sinn von schön, so wie man sagt, Florenz ist schön. Nein, was Honolulu hat, ist das gewisse Etwas. Die Menschen hier sind extrem freundlich (erstaunlich, bei über 7 Mio. Besuchern im Jahr), hilfsbereit und zusammen strahlt das einen ganz eigenen Charme aus. Es gibt nette Cafés, Kneipen und sogar Restaurants, die etwas anderes als Burger, Pommes oder Caesar’s Salad anbieten. Irgendwie ist es dann auch komisch, über die Kalakaua Avenue zu bummeln. Hier finden sich all jene Läden, die sich auch auf der Fifth Avenue in New York oder der Maximilianstraße in München finden. Auch wenn es irgendwie logisch ist, solche Läden auch hier zu finden, ist es doch auch seltsam. Aber von den 900.000 Einwohnern Oahus (75% aller Bewohner des Archipels) wird es wohl auch den einen oder anderen geben, der hier lebt und dementsprechend shoppt. Die Jaguars und Mercedes’ vor den Türen mit hawaiischen Kennzeichen lassen auf jeden Fall darauf schließen.
Diese Mischung aus Chinatown, Aloha-Feeling, Kosmopolität, Offenheit und Freundlichkeit machen Honolulus Reiz aus. Honolulu hat es auf jeden Fall auf unsere imaginäre Liste derer Ort geschafft, an denen wir uns vorstellen könnten zu bleiben. Und zwar auf Anhieb auf Platz 1! Auch wenn wir zu Beginn des Tages nach unserer Ankunft ein eher trübes bis tristes Bild gemalt haben; diesen Eindruck haben die Menschen und deren Liebenswürdigkeit, diese aufregende und pulsierende Stadt und ihre Atmosphäre ,der Pazifik einfach weggeblasen. Honolulu, einst das Ziel von Kindheitsträumen, behält seinen Stellenwert im Reich der Träume und Sehnsüchte!
Wai Momi oder die Bucht der Perlen
Wai Momi hat seinen Platz in der Weltgeschichte. An diesem Ort sollte sich der Lauf der Dinge ändern, eine neue Ära eingeläutet werden. An diesem Ort brach das Verderben über Hawaii herein. Wai Momi wurde mit einem Schlag weltbekannt und all das an nur einem einzigen Tag. Es war der 7. Dezember 1941.
In einer 11 Tage dauernden Reise gelingt es den japanischen Kampfverbänden, dem Kido Butai (bestehend aus 6 riesigen Flugzeugträgern), sich nördlich der üblichen Handelsrouten unentdeckt bis auf 350 km Hawaii zu nähern. Um 6:00 Uhr morgens am 7. Dezember 1941 startet die erste Staffel (bestehend aus 183 Flugzeugen) Richtung Honolulu und Pearl Harbour mit dem Ziel, einen Großteil der amerikanischen Pazifikflotte zu versenken bzw. zu vernichten. 30 Minuten später wird die zweite Staffel aufsteigen, um all jenes zu bombardieren, was die erste „vergessen“ hatte. Um 7:55 Uhr funkt Mitsuo Fuchida, Geschwaderkommandant der ersten Staffel, das berühmte „Tora Tora Tora“.
Interessant hierbei ist die zweifache Interpretation des Funkspruchs: Der Funkspruch Fuchidas (eigentlich to ra, to ra, to ra) war letztlich das Signal, dass der Überfall in der Variante für vollständige Überraschung durchzuführen war, mit den Torpedobombern zuerst, bestehend aus to für totsugeki (Angreifen) und ra für raigeki (Torpedos/Torpedobomber). Die Amerikaner haben zwar das „to ra, to ra, to ra“ empfangen, jedoch nicht verstanden und machten daraus „Tora, Tora, Tora“ (japanisch für Tiger, Tiger, Tiger).
Wenige Minuten später ist der Angriff auch schon im vollen Gange. Um 8:10 Uhr sinkt die USS Arizona mit 1.177 Mann an Bord in neun Minuten. Um 8:40Uhr trifft die zweite Staffel ein. Um 10:00 Uhr drehen die Maschinen der zweiten Staffel ab und nach nicht einmal 2 Stunden und 20 Minuten ist der Angriff vorbei. Auf amerikanischer Seite belaufen sich die Verluste auf 5 gesunkene sowie 3 beschädigte Schlachtschiffe, 3 beschädigte Kreuzer und 3 beschädigte Zerstörer. Dazu 188 zerstörte und 155 beschädigte Kampfflugzeuge, 2.403 Tote und 1.178 Verletzte. Nur die Anschläge auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 sollten mehr Todesopfer mit einem Schlag auf amerikanischem Boden und in der amerikanischen Geschichte kosten. Auf japanischer Seite halten sich die Verluste in Grenzen: 29 zerstörte Kampfflugzeuge, 5 gesunkene Mini-U-Boote, 1 Gefangener und 61 Tote.
Von all dem Grauen ist heute nicht mehr viel zu sehen, außer dass jährlich ca. 1,5 Millionen Besucher zu dem USS Arizona-Memorial strömen. Die USS Arizona wurde weder geborgen noch abgewrackt und liegt so, wie sie am 7. Dezember 1941 sank, am Boden des Hafenbeckens, knapp unter der Wasseroberfläche. Besichtigen kann man das Ganze von einer Art Brücke, die quer über das Wrack gebaut wurde. Sehen kann man eigentlich nichts, außer ein paar verrostete, aus dem Wasser ragende Wrackteile.
Das Besucher-Center, in den Reiseführern als sehenswert dargestellt, entpuppt sich eher als ein Fleckerlteppich von Postern, Zeitungsausschnitten und Memorabilia. In der Mitte sitzt ein Veteran und unterschreibt sein Buch. Und überhaupt ist jeder Pearl Harbour-Veteran ein Held – auch wenn er am 7. Dezember 1941 auf Urlaub war.
Insgesamt verbringen wir mit Warten und Ansehen eines recht interessanten Filmes knapp 3 Stunden in Pearl Harbour und sind froh, wenigstens um die stundenlange Warterei auf Einlass herumgekommen zu sein. Schließlich waren wir früh da. Beim Verlassen hören wir die Dame am Ticketschalter noch sagen, dass es jetzt 5 ½ Stunden dauere, bis das nächste freie Boot zur USS Arizona ablege. Das wäre es definitiv nicht wert gewesen!
Der Nuuanu Pali Drive, der Tantalus Drive und das Valley of Temples
Ein paar Fahrminuten außerhalb Honolulus dringen wir über den Nuuanu Pali-Drive in den Regenwald vor. Diese Straße führt leider nur auf wenigen Kilometern durch eine Landschaft, wie man sie aus Filmen wie Jurassic Park kennt. Wild, undurchdringlich und tief grün. Von den Bäumen hängen Lianen, man ist versucht zu glauben, Tarzan habr sich hier leichtbekleidet und Affenlaute imitierend zu seiner blonden Urwaldschönheit geschwungen. Es ist unglaublich, wie schnell man aus der pulsierenden Stadt in eine archaisch anmutende Landschaft gelangt. Am Ende dieser Tour öffnet sich die Landschaft, ein Parkplatz liegt vor uns, und wir sind an eben jener Stelle, an der König Kamehameha I. 1795 seine Gegner mit Macheten und Gewehren in den Tod trieb. Hier, heute ein Lookout, stürzten sich damals mehrere Hundert seiner Gegner verzweifelt die 200 Meter hohen Klippen hinunter in den sicheren Tod.
Noch viel beeindruckender und erfahrenswerter ist jedoch der 14 km lange Tantalus-Drive. Durch dichten, undurchdringlichen Regenwald mit Eukalyptus-, Bambus-, Banyan- und Ingwerbäumen schlängelt sich die Straße den Berg, die Maiki Hights, hinauf. An zahlreichen Stellen laden Wanderwege dazu ein, den Wald von innen zu erkunden. Ist man erst einmal ein paar Minuten unterwegs, hat man fast schon vergessen, soeben noch in Honolulu gewesen zu sein. Oft fahren wir rechts ran, schalten den Motor aus, kurbeln die Fenster runter und lauschen dem ohrenbetäubenden Gezwitscher der Vögel. Auch wenn es klischeehaft klingt, es ist wunderbar und einzigartig. So viele Vögel hört man in den größten Zoos der Welt nicht und schon gar nicht in einer solch fabelhaften Landschaft.
Im Nordosten der Insel, nahe Kailua (dort urlaubte Barack Obama) liegt das Valley of Temples, das Tal der Tempel. Hierbei handelt es sich eher um einen Religionen übergreifenden Riesenfriedhof. Und wie sollte es auch anders sein, er ist für die lauffaulen Amerikaner automobilistisch perfekt erschlossen. Auf einer Art Ringstraße kann man bequem durch Felder voller letzter Ruhestätten aller hier ansässigen Religionen fahren. Eigentlich wäre dieser Friedhof nicht wirklich der Reise wert, gäbe es da nicht den berühmten Byodo-In-Tempel. Über eine rot lackierte Holzbrücke gelangt man zu diesem hübschen buddhistischen Tempel, dessen Name so viel wie „Tempel der Gleichheit“ bedeutet. Hier finden wir eine bezaubernde Oase der Ruhe.
Das noch keine 40 Jahre alte Bauwerk, ist ein Nachbau des 900 Jahre alten Tempels von Uji in Japan und wurde zum 100-jährigen Jubiläum der Ankunft der ersten japanischen Einwanderer 1968 gebaut und eingeweiht. Einige Schritte vom Hauptgebäude entfernt, hängt in einem Pavillon eine 3 Tonnen schwere, in Japan gegossene Glocke. Ein kleines Schild weist den Besucher darauf hin, dass ein Läuten der Glocke zusammen mit einer Spende dem Läutenden Glück bringt. Wir läuten und spenden beide – nichts. Schließlich kann man Glück nicht kaufen. Im Haupttempel zünden wir ein angenehm duftendes Räucherstäbchen an und lassen dann doch ein paar Dollar für den Tempel und seinen Erhalt. Schließlich ist er so schön, und die vielen Busladungen jeden Tag (wir unterstellen dies einfach mal) trampeln durch, lassen die Nikons klicken und denken sich, die Spende sei sicher mit dem All-Inclusive-Paket abgedeckt.
Wir spazieren noch eine Weile durch die Tempelanlage mit ihren verspielten Gärten, genießen die Stille und Besinnlichkeit. Dann geht es zurück in die größte Stadt im Pazifikraum, nach Honolulu.
Von Wellen, coolen Typen und der Surf-WM
Sunset Beach und Banzai Pipeline. Das sind Namen, bei denen die Herzen von Surfern – also Wellenreitern und NICHT Windsurfern (diesen Affront leistet man sich hier nur einmal) – höher schlagen.
Im Winter, wenn die Brandung über Tausende von Kilometern, mit Kraft und Wucht gespeist, auf die Küste trifft, schafft sie Wellen von atemberaubender Schönheit und sagenhafter Größe. Bis zu 13 Meter hoch können sich diese auftürmen, bevor sie sich mit einer schier unvorstellbaren Gewalt am Riff brechen und schließlich am Sandstrand ausrollen. Noch die auf den Strand treffenden Reste einer solchen Welle reißen uns fast die Füße weg. Diese Kraft ist unvorstellbar. Wir würden es noch nicht einmal drei Meter ins Wasser schaffen, ohne von der Wasserwacht wieder herausgezogen werden zu müssen.
 Wir haben enormes Glück. Wir sind am 4. Dezember am Sunset Beach und es ist Finaltag des O’Neil-Worldcup of Surfing! Für solche Wellen und für ein solches Event kann man sich nicht einfach anmelden – nein, man muss sich qualifizieren. Und was das bei solchen Wellen bedeutet, können wir uns als Luftmatratzenwellenreiter im Mittelmeer wohl nicht mal ansatzweise vorstellen. Die Jungs bewegen sich mit einer Lockerheit und Lässigkeit in diesem zerstörerischen Element, dass uns der Atem stockt. Es schaut so einfach aus (wie fast jeder Sport, allen voran Golf, bei dem vornehmlich Rentner einen Knüppel schwingen, um einen kleinen weißen Ball möglichst weit über den Rasen zu schussern). Und doch würden wir uns für kein Geld dieser Erde auch nur fünf Sekunden zwischen diesen Wellenbergen auf eines dieser Bretter hocken. Das wäre Ersaufen auf hohem Niveau.
Wir haben enormes Glück. Wir sind am 4. Dezember am Sunset Beach und es ist Finaltag des O’Neil-Worldcup of Surfing! Für solche Wellen und für ein solches Event kann man sich nicht einfach anmelden – nein, man muss sich qualifizieren. Und was das bei solchen Wellen bedeutet, können wir uns als Luftmatratzenwellenreiter im Mittelmeer wohl nicht mal ansatzweise vorstellen. Die Jungs bewegen sich mit einer Lockerheit und Lässigkeit in diesem zerstörerischen Element, dass uns der Atem stockt. Es schaut so einfach aus (wie fast jeder Sport, allen voran Golf, bei dem vornehmlich Rentner einen Knüppel schwingen, um einen kleinen weißen Ball möglichst weit über den Rasen zu schussern). Und doch würden wir uns für kein Geld dieser Erde auch nur fünf Sekunden zwischen diesen Wellenbergen auf eines dieser Bretter hocken. Das wäre Ersaufen auf hohem Niveau.
Im Winter ist Hawaii der Austragungsort der Vans-Triple-Crown of Surfing-Meisterschaft. Hier werden die Könige und Königinnen dieser Sportart gekürt. Vom 12. November bis 20. Dezember messen sich hier in drei unterschiedlichen Contests die Besten der Besten der Welt miteinander.
Surfen in 13 Meter hohen Wellen zu beschreiben, ist schwer. Daher unser Tipp: Schauen Sie sich einfach die unglaublichen Videos auf www.triplecrownofsurfing.com an. Uns fallen nur einige Adjektive dazu ein: vom jovialen geil über sagenhaft, atemberaubend, unglaublich, unmöglich, halsbrecherisch, extrem oder schlicht ein lang gezogenes Wow! Alles träfe zu. Beschreiben tut‘s aber keines dieser Wörter wirklich, was wir gesehen haben.
Die Schuhe voller Sand geht es weiter. Aloha!